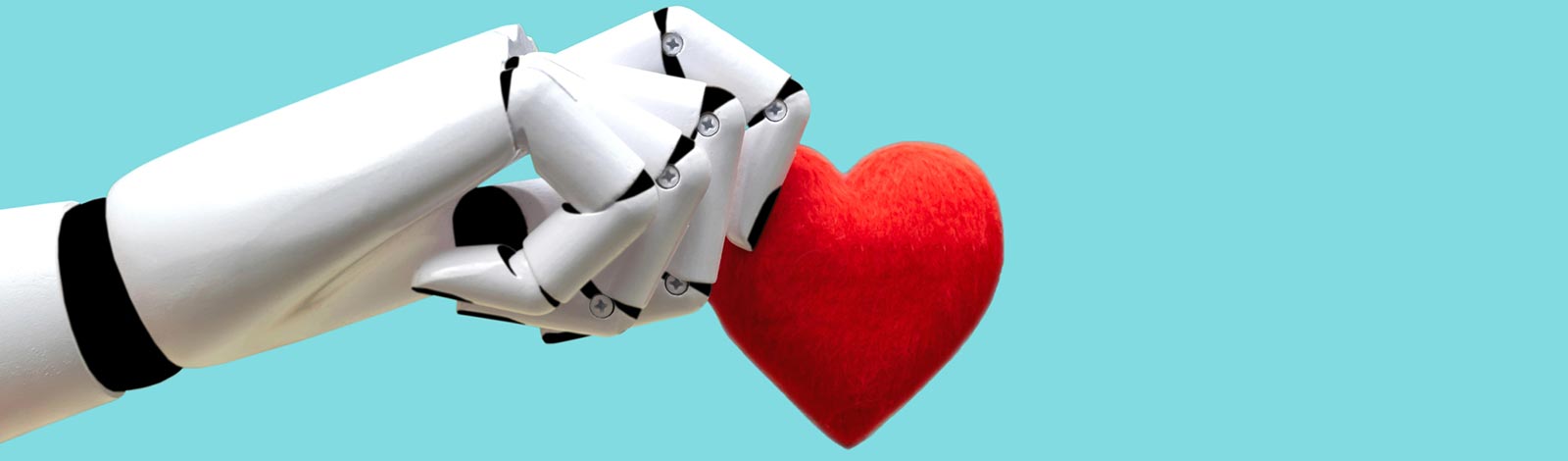echnologieangst kann jedoch nicht die alleinige Erklärung dafür sein, dass die digitale Zukunft von nicht-europäischen Konzernen dominiert wird. Erwähnt seien an dieser Stelle vier offensichtliche Defizite, auch wenn diese in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten unterschiedlich stark ausgeprägt sein können:
- IKT-Pioniere suchen in Europa häufig vergeblich nach Frühphasenfinanzierung.
- Öffentliche Investitionen in die IKT-Infrastruktur wurden jahrelang vernachlässigt und verzögern damit den technischen Fortschritt.
- Programmieren gehört auch unter der jüngeren Generation noch immer nicht zu den Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben. In einer älter werdenden Gesellschaft droht vielen Menschen der Ausschluss von digitalen Arbeitsplätzen.
- Um im internationalen Wettbewerb zu bestehen, fehlt es an europäischen Digitalkonzernen, die über eine kritische Masse an Einfluß verfügen, um neue Standards zu setzen.
Zu den Errungenschaften einer europäischen Digitalstrategie zählt sicher die Datenschutzgrundverordnung. Für die wirksame Bekämpfung von Hassbotschaften, Fake News und Cyberkriminalität bedarf es vergleichbarer EU-Reglungen. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass in Zukunft nicht-europäische Staaten vermehrt in die Freiheit des Internets eingreifen werden. Um angemessen auf einen solchen digitalen Protektionismus reagieren zu können, bedarf es eines ganzheitlichen Instrumentariums, dessen Anwendung von allen Mitgliedsstaaten unterstützt werden muss.